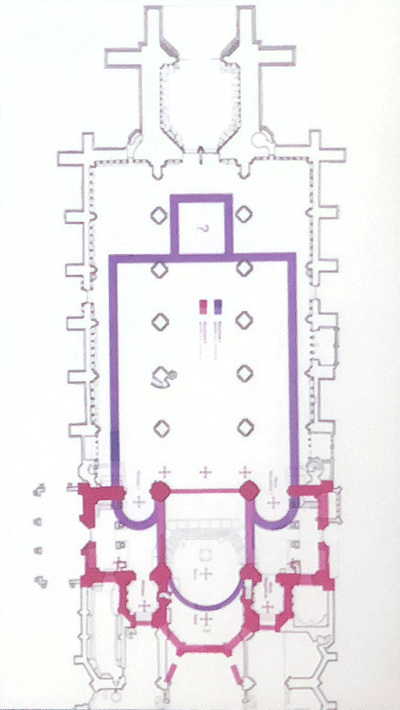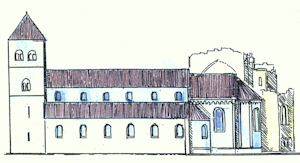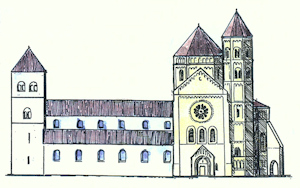Bertold, ein Herzog ohne Herzogtum?
Bertold, genannt der Bärtige (1061-1078), Graf mit Sitz auf der Limburg
bei Weilheim an der Teck, herrscht um 1050 über Gebiete in der Ortenau, dem
Thurgau, dem Breisgau und auf der Baar. So ist
es nur natürlich, dass Kaiser Konrads Sohn,
Heinrich III. (1039-1056) seinem
treuen Parteigänger das Herzogtum Schwaben
verspricht und ihm zum Pfand seinen Ring gegeben haben soll. Doch als Heinrich 1056 stirbt und im gleichen Jahr
Rudolf von Rheinfelden (1077-1080) die Kaisertochter
Mathilde entführt, gibt Heinrichs
Witwe Agnes (1056-1077) ihrem Schwiegersohn Rudolf das Herzogtum im Namen ihres noch unmündigen
Sohnes, des späteren Kaisers
Heinrich IV. (1056-1105).
Bertold protestiert und bekommt zum
Trost im Jahre 1061 das weit entfernte Herzogtum Kärnten und die
Markgrafschaft Verona zum Lehen. Bertold, nun mit dem Titel Herzog, sieht
wohl ein, dass er seine Macht in den fernen Gebieten schwerlich durchsetzen kann
und hält sich lieber am Rhein auf. Nicht nur der Histograph der Staufer
Otto von Freising verspottet Bertold deshalb als Herzog ohne Herzogtum
[Krum70].
Im Investiturstreit hält Bertold I. zusammen mit den Herzögen
Welf IV.
von Bayern und Rudolf von Schwaben zu den Gegnern Heinrichs IV. und wählt,
nachdem Reformpapst
Gregor VII. den König gebannt hatte, im März 1077 mit
anderen deutschen Fürsten seinen ehemaligen Konkurrenten Rudolf in Forchheim
zum Gegenkönig. Als Bertold Rudolf anschließend zur Weihe und Krönung nach
Mainz geleitet, entzieht ihm König Heinrich nicht nur seine Lehen, sondern
ächtet den nun nicht mehr Herzog von Kärnten 1077 auf dem Hoftag zu Ulm.
Bertold verlässt den Breisgau und zieht sich auf seine eigenen Besitzungen zurück, wo er angeblich
wegen der vielen Schicksalsschläge am 5. oder 6. November 1078 auf der
Limburg im Wahnsinn stirbt, In scharfer Abgrenzung zu Heinrich IV. bezeichnen
einige Chronisten Herzog Bertold als christiane religionis amator et
defensor studiosus* [Zotz18a].

Aus dem Felsen gehauener Halsgraben der Kyburg [Ries21].
Und doch hätten die Zäringer den Breisgau nicht ganz aufgegeben. So soll die
Kyburg oberhalb Günterstal in ihrem Besitz geblieben sein. Dieser Stützpunkt
erleichtert dem Sohn Bertolds I. 1078 die Rückkehr in den Breisgau [Ries21].
Das schöne Castrum de Friburch 1091
Die beiden ältesten Söhne Bertolds I.
Hermann (1061-1074) und Bertold (1078-1111)
teilen das Herrschaftsgebiet des Vaters auf, wobei Hermann als Graf von
Freiburg und Markgraf von Verona auf der Baar bleibt. Damit wird er zum
Ahnherrn der Markgrafen von Baden.
Der jüngste Sohn Bertolds I.,
Gebhard (1050-1119), ergreift wie für Söhne ohne Erbanspruch häufig üblich einen
geistlichen Beruf. Er tritt in das Kloster Hirsau ein, wird anschließend
Stiftsprobst von Xanten und 1084 Bischof von Konstanz [Zotz18a].

Im Altarraum der Klosterkirche von St. Peter:
St. Gebhardus III Dux Zaeringenis Episcopus Constantinsis confundator in prioratu Richenbacens Wurtenberg
sepultus MCX
Als Hermann von den damaligen religiösen Reformbestrebungen beeinflusst 1073
Frau und Sohn verlässt, sein Seelenheil im Kloster Cluny sucht und dort ein
Jahr später stirbt, ist Bertolds I. zweitältester Sohn am Zug. Ihn zieht es
als Bertold II. von der Limburg westwärts.
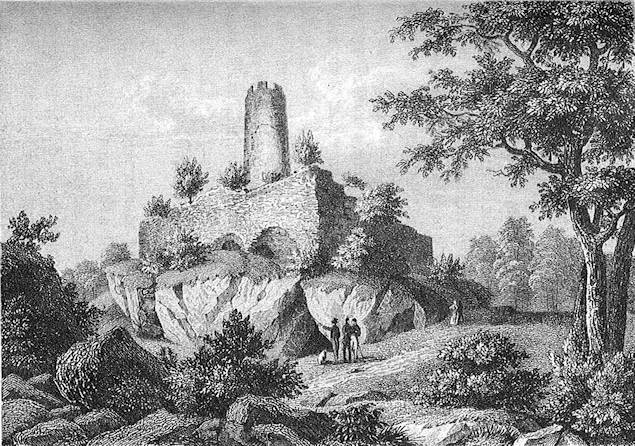
Ruine der Zähringer Stammburg.
Romantischer Stich aus dem
19. Jahrhundert.
Oberhalb des Dorfes
Zähringen errichtet Bertold II. auf Reichsgrund die Stammburg, die den Namen seines
zukünftigen Geschlechts tragen wird. Nach seiner Vermählung mit Agnes von Rheinfelden,
der Tochter des Gegenkönigs Rudolf, erstreckt sich Bertolds Herrschaftsgebiet um 1079 in die heutige Schweiz über Langenthal und Bern bis
zum Thunersee und zur Aare. Gleichzeitig setzt er energisch seine Macht
im Breisgau durch. So gestärkt meldet der Herzog ohne Herzogtum seinen
Anspruch auf das Herzogtum Schwaben an.
Doch es gilt auch hier divide et impera und noch ist
Bertolds Vaters Verrat nicht vergessen. So verlobt Heinrich
IV. 1079 den Staufer
Friedrich I. (1079-1105), mit seiner siebenjährigen Tochter
Agnes, belehnt den zukünftigen Ehemann mit Schwaben und macht ihn damit
zum Herzog.
Da mag Bertold nur wenig getröstet sein, als ihm im gleichen Jahr der Basler
Bischof das Bergregal im Schwarzwald als Lehen übergibt. Mit der
Erschließung neuer Silbergruben und deren Ausbeutung wird der Zähringer bald
zum wohlhabenden Mann. Deshalb beschließt er 1091, aus der ihm nur als
Reichslehen überlassenen Stammburg auszuziehen und auf seinem
Eigengut, dem militär- und handelsstrategisch
vorteilhaft gelegenen Schlossberg, das Castrum de Friburch zu bauen.
Das im romanischen
Stil errichtete und später als Burghaldenschloss bezeichnete Bauwerk hat
Hartmann von Aue als ein prächtiges Schloss in deutschen Gauen besungen.
Nach der Chronicon Helveticum
soll es eines der schönsten Schlösser weit und breit gewesen sein. Belegt
ist die Existenz der Burg jedoch erst seit 1146, als
Bernard von
Clairvaux in seinen Reisetagebüchern beschreibt, dass er
apud castrum Frieburg (bei der Festung
Freiburg) einen blinden Knaben heilte [Scha88].
|
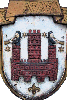







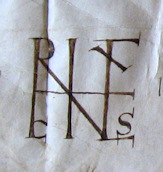

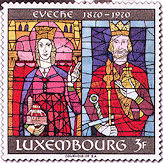




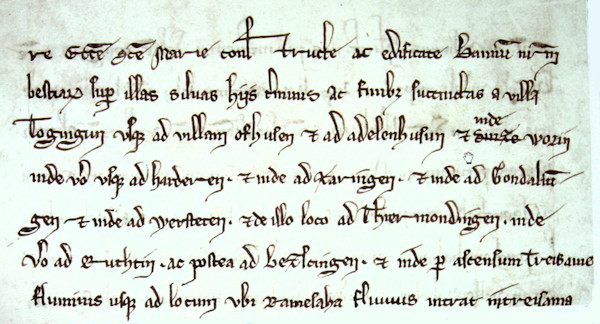

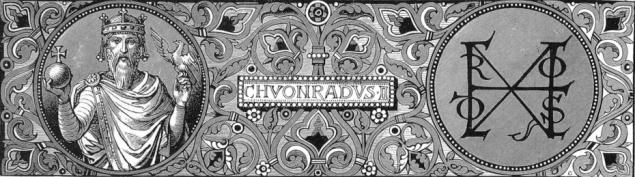





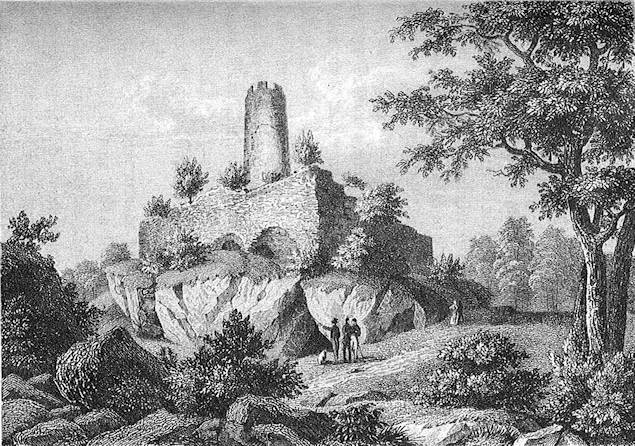

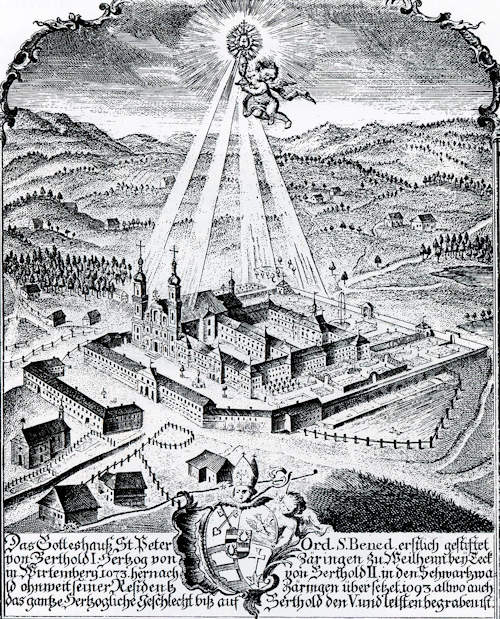





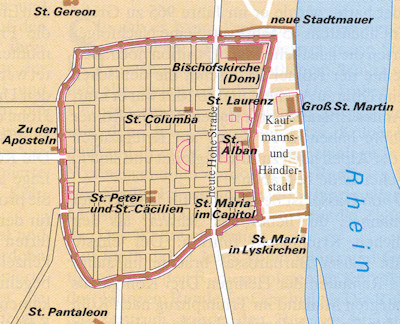

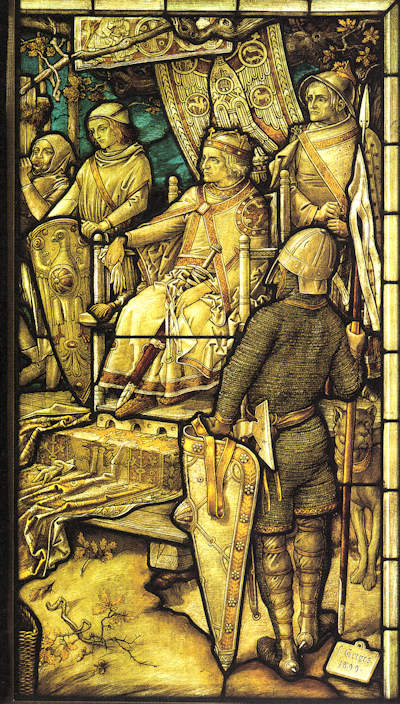




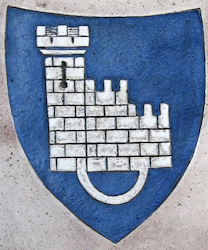








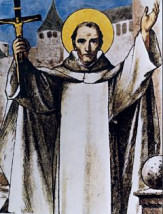







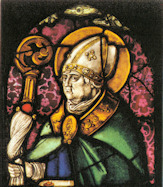

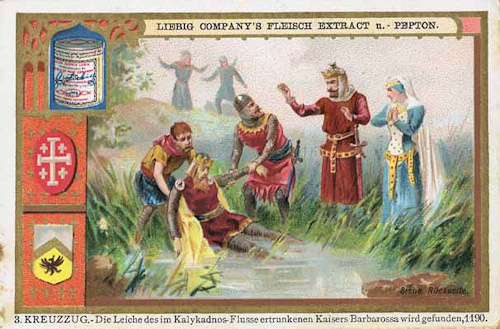
 Bertoldo
V
Bertoldo
V